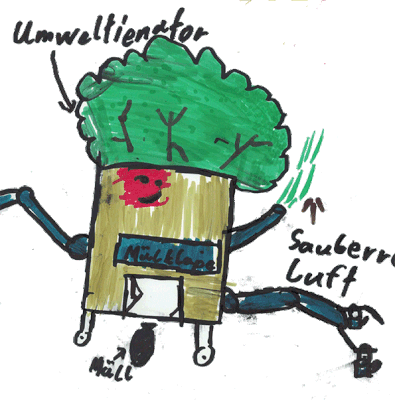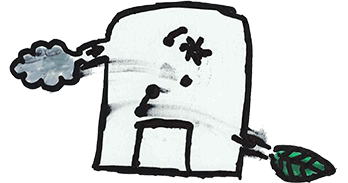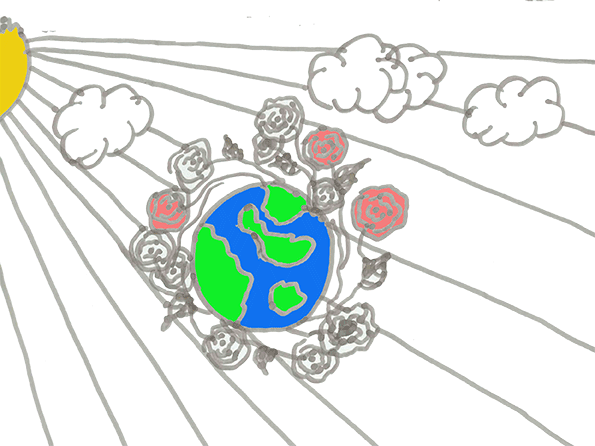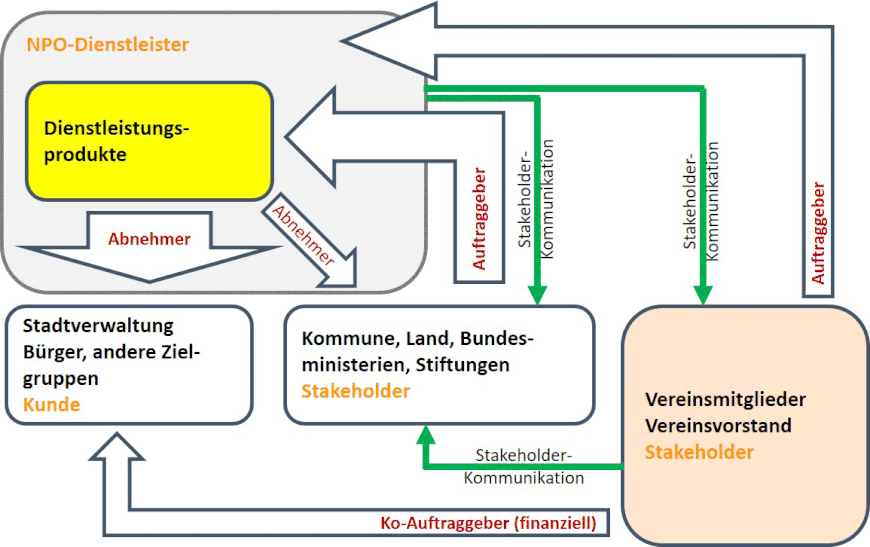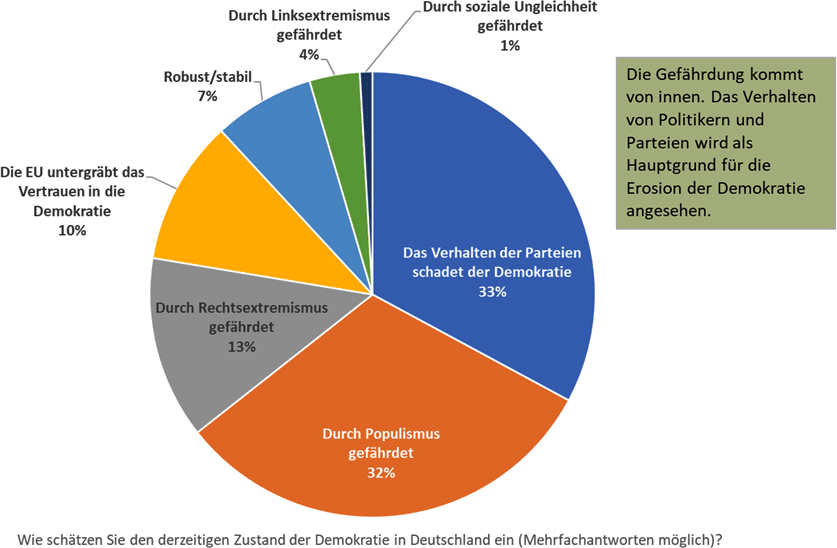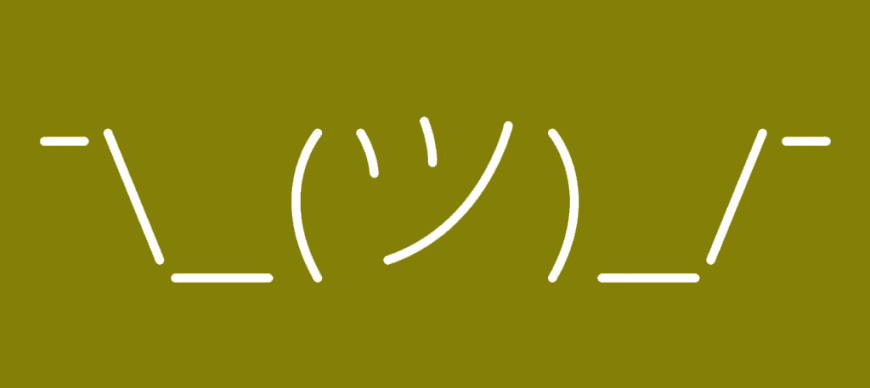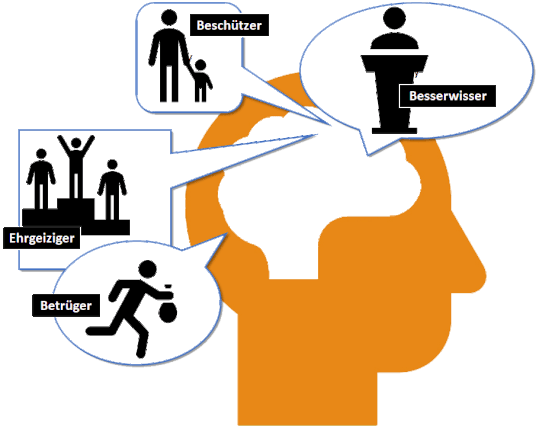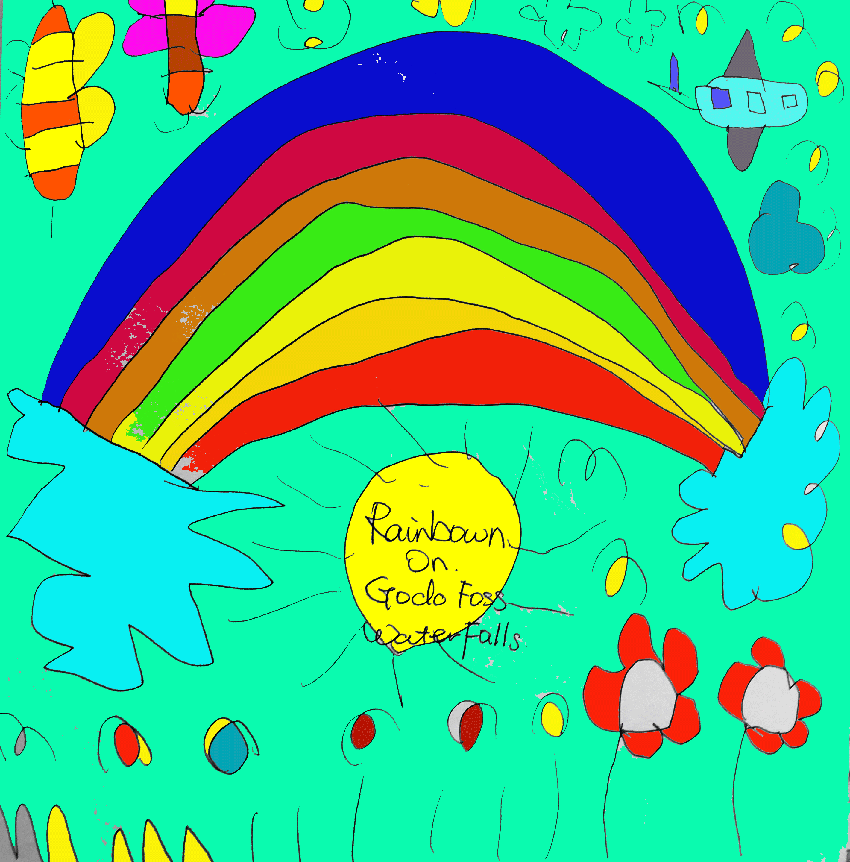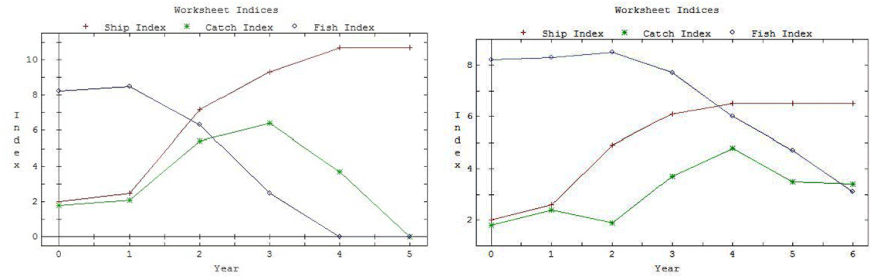Kinder sind die Zukunft - wirklich?
Dezember 2018
Es klingt, wie eine Binsenweisheit – unsere Kinder sind die Zukunft. Klar, die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen und sie werden die Zukunft prägen – ihre Zukunft. Aber wie sinnvoll ist es, wenn wir heutige Erwachsene unsere Zukunftshoffnungen und die Idee einer „nachhaltigen“ Welt auf die Kinder projizieren? Wer zurückdenkt an seine eigene Kindheit, der wird keinen Zweifel haben: Die Vorstellungen unserer Eltern, wie eine „gute“ Welt aussieht, war nicht das, was uns motiviert hat, erwachsen zu werden. Die Zukunft wohl niemals so aus, wie Eltern- und Großelterngenerationen sie sich ausgemalt haben mochten. Und das wird vermutlich die nächsten Jahrhunderte nicht anders sein.
Dennoch beschäftigen sich heutige Grundschüler-Generationen sehr mit der Zukunft. Oder soll man sagen, sie werden von ihren Eltern, Lehrer/innen und Erzieher/innen damit beschäftigt? Und ist es dann weniger eine offene, abenteuerliche, herausfordernde Zukunft als vielmehr die Zukunfts-Angst de Erwachsenen, mit der sich die Kinder auseinandersetzen?
Wir haben die Gelegenheit genutzt, Berliner Grundschüler/innen der dritten und vierten Klasse im Rahmen eines Vorlesertages zu fragen, wie sie sich die Welt im Jahr 2030 vorstellen, wenn sie selbst Anfang ihrer zwanziger Jahre sein werden. Tatsächlich reproduziert etwa die Hälfte der Kinder die gängigen Leitvorstellungen des sozial-ökologischen Bewusstseins, wie es von Medien, Schule und Elternhäusern kultiviert wird:

- Die Welt sollte grüner sein
- Im Meer liegt ganz viel Plastik, dadurch sterben die Tiere
- Aufhören, so viele Bäume zu fällen
- Ich will nicht so viel Müll produzieren
- Gerechtigkeit auf der Welt
- Man muss die Natur schützen!
- Weniger Plastik, weniger Palmöl, mehr Bäume, mehr Natur!
- Nicht so viele Autos, vor allem keine Dieselautos.
Ein typisches Bildmotiv dieser Kinder ist das Verbotsschild (Fany, 2030 21 Jahre alt).
Man mag sich fragen, wie viel persönliche Erfahrung und eigene Ideen hinter solchen Äußerungen stehen. Bei einem Teil der Kinder wird mehr Eigenes sichtbar. Z.B. bei Nibelle, die 2030 23 Jahre alt sein wird und sich überlegt:
- „Wie wohl die Welt in 12 Jahren aussehen wird? Wird es noch Autos geben? Oder fliegende Autos? Und was wird aus Berlin? Vielleicht so wie früher in der Steinzeit oder wie in der Wikingerzeit. Wer weiß?“
Häufig beschäftigen sich die Grundschüler auch mit technischen Lösungen für heutige Umweltprobleme und legen dabei persönlichen Ehrgeiz an den Tag, wie Samuel, der 2030 dann 22 Jahre alt sein wird:
- „Ich würde gerne Autos erfinden, die nur am Anfang des Losfahrens Energie verbrauchen und während der Fahrt durch die Reifen sich selbst aufladen mit Energiestrom. Außerdem das coolste Buch, das es je gegeben hat, schreiben, dass es jeder liest. Außerdem werde ich eine Maschine erfinden, die CO2 und Stickstoff in Sauerstoff umwandelt. Wenn Bäume das können, können wir das auch!“
Die Bilder, die solche Vorstellungen illustrieren, zeigen z.B. ein Flugzeug, das als „CO2-Einsauger“ Mobilität mit Klimaschutz verbindet (Filip, 2020 22 Jahre) oder kunstvolle Apparate, die aus Müll saubere Luft machen (Felix, 2030 wird er 24 Jahre alt sein), Connor (2030 23 Jahre) nennt seine entsprechende Maschine den „Happy Umweltgenerator“. Ein anderer Junge hat das Prinzip genial vereinfacht dargestellt – Grau rein, Grün raus.
Immer noch sind es vor allem die Jungs, die sich mit den technischen Lösungen beschäftigen, während die Mädchen dann doch die sozialen Fragen mehr interessieren. Mia, die 2030 23 Jahre alt sein wird, schreibt über ihre Welt in zwölf Jahren:
- „Ich will Freunde haben, die hinter mir stehen, Spaß haben. Und die für mich da sind, mir bei schwierigen Sachen helfen. Die mir mit auch mal Scheiß bauen, aber auch die mir zuhören und sie sollen zu mir ehrlich sein. Die umweltfreundlich sind, aber keine ÖKOTUSSIS sind.“
Überwiegend von Mädchen kommen Wünsche wie „kein Krieg mehr“, „dass sie nicht immer alles mit Gewalt klären“ und „nicht so viel Armut“. Das Bild einer von der Sonne bestrahlten und mit Rosen umkränzten Erde stammt von Milla (2030 23 Jahre alt).
„Wenn Bäume das können, können wir das auch“ und „umweltfreundlich, ohne Ökotussis zu sein“ – manche der Kinder, die unsere Zukunft sind, stimmen uns richtig hoffnungsfroh!
Non-Profit tickt anders?
Oktober 2018
Die (kapitalistische) Privatwirtschaft zu verstehen, ist eigentlich nicht so schwer. Hinter Wirtschaftsunternehmen steht ja die an sich recht einfache Logik: Produzent ==> Kunde. Oder wenn man es genauer nimmt Produzent ==> Handel ==> Kunde. Den Kundennutzen, den der Produzent generiert, honoriert der Kunde mit dem Kauf. Die Wertschöpfungskette ist klar und eindeutig. Beim Produzenten kommt zwar noch du Supply Chain hinzu, aber auch das macht das System nicht wesentlich komplexer: Lieferant ==> Produzent ==> Handel ==> Kunde.
Um ihr Umfeld abzusichern, bilden Unternehmen Verbände und entwickeln Lobbykontakte zu den wichtigen Stakeholdern. Außerdem engagieren sie sich im sozialen Umfeld. Aber dies sind flankierende Prozesse, die die grundlegende Funktionslogik nicht tangieren.
Bei Non-Profit-Organisationen (NPO) und Nichtregierungsorganisationen (NGO) ist es grundlegend komplexer. Das macht vor allem den NPO/NGO nicht selten Probleme. Denn ein Wirtschaftsunternehmen entlang der skizzierten Logik zu entwickeln, ist an sich eine klare Sache. Im Non-Profit-Sektor sieht es oft sehr viel verwirrender aus.
- Der Abnehmer der Dienstleistung einer NPO/NGO (Kunde, Zielgruppe) ist meist nicht der Auftraggeber (Zahler)
- Deshalb hat die dienstleistende NPO/NGO einen zweiten indirekten Kunden (Staat, Kommune, Stiftung etc.), den sie bei der Dienstleistungserbringung mitberücksichtigen muss
- Da der Non-Profit-Dienstleister als wirtschaftliche Einheit nicht selbstständig ist, agiert er quasi mit einem weiteren Auftraggeber, meistens einem ihn tragenden e.V., der nicht selten auch einen Teil der Finanzierung der Kundenaufträge übernimmt
- Der Dienstleister hat also einen Kunden und zwei Stakeholder gleichzeitig zu bedienen
- Neben der Dienstleistungsbeziehung, die auf Kompetenz, Performance und Compliance beruht, hat der Dienstleister auch eine Stakeholder-Beziehung sowohl gegenüber der geldgebenden Ebene als auch gegenüber der eigenen Trägerstruktur zu pflegen
- Der NPO-Dienstleister muss im eigenen Interesse eine funktionierende Stakeholder-Kommunikation mit beiden Stakeholdern aufrechterhalten, um sein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten
- Da der Trägerverein selbstständig ist, kann dieser auch von sich aus Stakeholder-Beziehungen zu Staat, Kommune etc. aufrechterhalten.
Was folgt aus dieser Komplexität für die NPO/NGO? Nicht selten ist es für die Mitarbeiter nicht leicht, anzuerkennen, dass die direkten Empfänger der NPO-Dienstleistung und die eigentlichen Auftraggeber zwei verschiedene Nutzenerwartungen an die NPO/NGO haben, die auch beide gleichrangig bedient werden müssen. Erfolg bei der „Zielgruppe“ der NPO/NGO reicht nicht aus, um das Geschäft und die Organisation abzusichern.
- Differenzierung: Die erfolgreichen Dienstleistungs-Sektoren werden von der zivilgesellschaftlichen Sphäre getrennt. Ein Beispiel ist die Organisation von Green City (München), die den Verein, die Energieproduktion und die Beratungs-Dienstleistungen unter einem Dach sauber trennt.
- Politisierung: Die NPO entscheidet sich dagegen, sich als Dienstleister weiter zu profilieren und sich als dauerhafter Förderprojektnehmer zu refinanzieren; stattdessen werden Mitgliedsbeiträge und Förderspenden genutzt, um sich Freiraum für eigene politische Initiativen zu verschaffen.
- Social Entrepreneurship: Die Lösungen, die die NPO-Struktur als Dienstleister entwickelt, haben unternehmerisches Potenzial und werden in eine betriebswirtschaftliche Struktur überführt, die sich aus dem direkt in der Zielgruppe generierten Ertrag speist.
Die Gefährdung der Demokratie kommt von innen – aber auch die Rettung?
September 2018
In unserer Sommerumfrage wollten wir von unseren Kunden und Stakeholdern wissen, wie es in ihren Augen um die Demokratie steht – und was und wer ihr helfen könnte, aus einer vielfach wahrgenommenen Krise herauszukommen. Knapp 100 Personen (exakt 96) haben sich beteiligt. Das sind nicht viele, aber sie stehen für eine Gruppe von Menschen in Deutschland, die sicher besonders interessiert und zukunftsbewusst sind.
Die überwältigende Mehrheit scheint davon überzeugt, dass unsere Demokratie in schlechter Verfassung und alles andere als robust und stabil ist. Wo werden nun die Ursachen dafür gesehen?
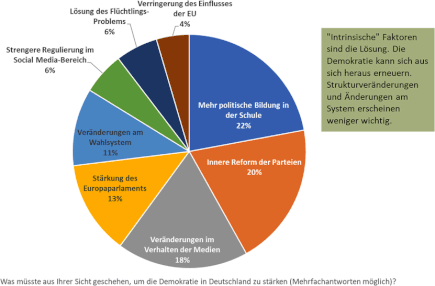
Erstaunlicherweise steht die Gefährdung von innen als Ursache weit vorne. Das Verhalten von Politikern und Parteien wird als Hauptgrund für die Erosion der Demokratie angesehen. Zwei Drittel der Aussagen zielen darauf ab. Die Parteien selbst und der grassierende Populismus stehen im Fokus des Problems. Rechts- und Linksextremismus werden im Vergleich dazu als weniger bedeutsam angesehen und die EU – heutzutage Zielscheibe nationalistisch-populistischer Anfeindungen – wird kaum als Grund für die demokratische Entfremdung verstanden.
Dazu passt, dass auch die Lösungen für die Krise der Demokratie eher in „intrinsischen“ Faktoren gesucht werden. Die Demokratie kann sich nach Meinung unserer Umfrageteilnehmer aus sich heraus erneuern. Strukturveränderungen und Änderungen am System erscheinen weniger wichtig. In erster Linie setzt man auf die politische Bildung in der Schule, die innere Reformkraft der Parteien und ein selbstkritischeres Verhalten der Medien. Wie andere Umfragen derzeit auch zeigen, steht das Flüchtlingsthema gar nicht im Vordergrund.
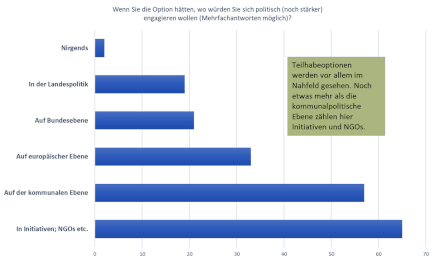
Insgesamt zeichnet sich also ein eher „idealistisches“ Bild ab, bei dem man sich fragen kann, ob es nicht mehr ein Teil des Problems als ein realistischer Ansatz zur Lösung ist. Demokratie hat bisher doch nur deshalb funktioniert, weil Normsysteme institutionell verankert waren, die Gewaltenteilung nicht angetastet wurde und innerparteiliche Demokratie herrschte – also ein gewisser „Zwang“ zur Demokratie im System verankert und auf der Verfahrensebene festgesetzt war. Wenn sich nun zunehmend „Bewegungen“ anstelle der Parteien setzen und das „Unten“ und „Oben“ der Politik nicht mehr durch Parteien und deren demokratische Willensbildung miteinander verbunden wird, scheint ein wichtiger Systembaustein wegzubrechen. Stoßen wir an Systemgrenzen der Demokratie? Müssen wir die Idee einer weiteren Ausbreitung der Demokratie als Organisationsprinzip komplexerer, sogar übernationaler Gesellschaften begraben? Ist die „Vision“ der Europäischen Union tot? Sogar die Zielgruppe, die wir in unserer kleinen Umfrage erreicht haben, fokussiert sich politisch anscheinend auf das Kleine und Überschaubare. Teilhabeoptionen werden vor allem im Nahfeld gesehen. Noch etwas mehr als die kommunalpolitische Ebene zählen hier Initiativen und NGOs. Überfordert uns die Demokratie im Zeitalter der Globalisierung?
Das Upgrade für die Demokratie – Methode, nicht Moral
Juni 2018
Dass unsere Demokratie in die Krise gerät, ist längst kein Geheimnis mehr. Sinkende Wahlbeteiligung und der Zulauf zu populistischen Parteien sind Symptome, hinter denen eine chronische Auszehrung des demokratischen Prinzips steht. Die heutige Praxis der demokratischen Beteiligung und Wahlentscheidung erweist sich immer mehr als unfähig, konsensfähige Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit hervorzubringen. Stattdessen erzeugt das System zu viele Verlierer und immer mehr Unzufriedenheit.
Gutmeinende appellieren angesichts des Erosionsprozesses an Werte und Ideale einer offenen Gesellschaft, ohne jedoch mehr als Resonanz unter ohnehin Gleichgesinnten erwarten zu können. Parteien des „demokratischen Spektrums“ verstärken ihre Profilierungszwänge gegen „rechts“, ggf. um den Preis, selbst populistische Positionen zu besetzen. Beide Versuche zur Rettung der Demokratie – der moralische und der machtpolitisch getriebene – dürften das Problem kaum lösen oder es eher verstärken.
Dabei gibt es seit längerem einen wirklich fundierten Vorschlag zur Stärkung demokratischer Prozesse. Dieser Vorschlag ist ein methodischer und er kommt weder aus der Politikwissenschaft noch von Parteireformern. Seine Autoren sind Mathematiker und Informatikexperten, die sich mit Entscheidungstheorien beschäftigen. Menschen also, die Demokratie „rechnen“ können. Erich Visotschnig und Siegfried Schrotta können beweisen, wie falsch die Entscheidungen sind, die durch demokratische Verfahren zustande kommen. Nehmen wir ein Beispiel.
In einer Kommune bewerben sich fünf Politiker um des Bürgermeisters. Das sind die Ergebnisse des ersten Wahlgangs:
|
25 % |
22 % |
21 % |
17 % |
15 % |
|
Max Meier |
Felix Müller |
Sylvia Horn |
Dieter Busch |
Agnes Bauer |
Max Meier wäre mit einfacher Mehrheit gewählt. Sollte eine Stichwahl vorgesehen sein, fände sie zwischen Max Meier und Felix Müller statt. Die Entscheidung scheint demokratisch, in Wahrheit verfälscht sie jedoch den Wählerwillen. Das wird offenkundig, wenn man die Zustimmung bzw. Ablehnung der Wähler zu allen fünf Kandidaten ins Kalkül zieht:
|
|
25 % |
22 % |
21 % |
17 % |
15 % |
|
Präferenz 1 |
Max Meier |
Felix Müller |
Sylvia Horn |
Dieter Busch |
Agnes Bauer |
|
Präferenz 2 |
Sylvia Horn |
Sylvia Horn |
Dieter Busch |
Sylvia Horn |
Sylvia Horn |
|
Präferenz 3 |
Agnes Bauer |
Dieter Busch |
Agnes Bauer |
Agnes Bauer |
Dieter Busch |
|
Präferenz 4 |
Dieter Busch |
Agnes Bauer |
Felix Müller |
Felix Müller |
Felix Müller |
|
Präferenz 5 |
Felix Müller |
Max Meier |
Max Meier |
Max Meier |
Max Meier |
Mit Felix Müller können sich 78 % der Wähler, mit Max Meier 75 % am allerwenigsten anfreunden. Sie haben die höchsten „Widerstands“-Werte. Dagegen wäre Sylvia Horn in der Stichwahl gegen Max Meier oder Felix Müller als Siegerin hervorgegangen, gegen die auch am wenigsten Widerstand unter den Wählern bestanden hätte.
Die zentrale Innovation des methodischen Vorschlags von Visotschnig/Schrotta liegt in der Erfassung der „Widerstandswerte“. Die Demokratiereformer fragen nicht nach der Zustimmung zu den einzelnen Entscheidungsalternativen, sondern nach dem relativen und abgestuften Grad des Widerstandes gegen die jeweiligen Alternativen. Dieses Verfahren, das natürlich nicht nur auf Entscheidungen zwischen Personen oder Parteien, sondern auch auf Sachentscheidungen angewandt werden kann, ergibt regelmäßig bessere Ergebnisse, die auf einem breiteren Konsens, sprich: minimalem Widerstand der beteiligten Wähler oder Entscheider beruhen.
Warum ist diese geniale Idee nicht schon längst breite Wirklichkeit geworden? Denn tatsächlich sind es bislang erst ein paar versprengte Kommunen – in der Steiermark und im Innviertel – und ein paar kleine Berater- und Trainingsunternehmen, die die Methode bisher entdeckt haben und einsetzen. Ein Grund mag in dem sperrigen und völlig marketinguntauglichen Namen liegen, den die beiden österreichischen Begründer der Methode ihrem Produkt gegeben haben: Sie sprechen vom „Systemischen Konsensieren“, abgekürzt SK. Da denkt man doch eher an Sozialpädagogik oder eine etwas esoterische Managementtechnik – und nicht an die Innovation, die das Upgrade für unsere Demokratie sein könnte. Also – es muss ein anderer Name gefunden werden!
Auf der kommunalen Ebene, wo Partei- und Machtpolitik naturgemäß eine geringere und reale Probleme und Sachfragen eine größere Rolle spielen, ließe sich die Methode sofort einsetzen und erproben. Damit würden Erfahrungen gemacht, wie man das Verfahren z.B. auch mit Online-Abstimmungen verknüpfen könnte, die wir unbedingt brauchen, um aus dem derzeitigen Dilemma zwischen Politikabstinenz und Populismus herauszufinden. Die Frage ist: Wer sind die Akteure, die dieses notwendige Experiment auf breiter Ebene in Gang setzen könnten?
Das aktuellste Buch zum Thema: Erich Visotschnig, Nicht über unsere Köpfe, 196 Seiten, oekom verlag München, 2018, EUR 20,00
Pragmatisch ist das neue nachhaltig
Februar 2018
Dieser Text folgt dem Impulsvortrag, den Richard Häusler am 24. Februar 2018 auf der "Zukunftstagung" im Rathaus von Augsburg gehalten hat.
Wir gestalten unsere Zukunft – nicht weniger verspricht uch diese Tagung heute in Augsburg, zu der ich die Ehre habe, eine Eröffnungsrede zu halten. Es ist modern geworden, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Seit sich die frühere Umwelt- und Friedensdebatte in eine „Nachhaltigkeitsszene“ verwandelt hat, fokussiert jeder, der Fortschritt und Verantwortung unter Beweis stellen will, auf diese ominöse „Gestaltung unserer Zukunft“. Was uns dabei zu denken geben sollte, ist die verblüffende Selbstverständlichkeit, mit der wir uns auf solchen Tagungen über die Zukunft auseinandersetzen - als ob man sich darüber tatsächlich in irgendeiner vernünftigen Weise auseinandersetzen könnte. Denn die Zukunft ist eine Fiktion. „Kein Mensch ist je dort gewesen“, stellt der Organisationsberater Michael Faschingbauer in seinem Buch über „Effectuation“ fest, das uns später noch interessieren wird. Der Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal hat die obsessive Beschäftigung mit der Zukunft bereits im 17. Jahrhundert kritisiert und als Dummheit bezeichnet, wörtlich: „„So dumm sind wir, dass wir in den Zeiten umherirren, die überhaupt nicht unser sind, und an die einzige Zeit, die uns gehört, gar nicht denken.“ Anscheinend neigte der Mensch der Neuzeit immer schon dazu, der Verantwortung für seine Gegenwart zu entfliehen.
Und das tut er in zwei Richtungen. Man kann an der Vergangenheit festhalten, sie heraufbeschwören und idealisieren. Alte Fassaden wiederaufbauen und Denkmäler vor jedwedem Veränderungszugriff schützen. In Potsdam soll beispielsweise demnächst die zerstörte Garnisonkirche im historischen Stil der preußischen Militärkirche aus dem 18. Jahrhundert wieder entstehen, ein Bürgerdialog dazu ist gescheitert, weil er von Anfang an nicht offen für eine gegenwartsbezogene Lösung gewesen zu sein scheint. Oder, auf der anderen Seite, ist es beliebt, die Idee zu kultivieren, man könne die „Zukunft gestalten“. Während viele Erscheinungsweisen der Vergangenheitssehnsucht uns starr und borniert erscheinen, zeichnet die Ausprägungen von „Zukunftsgestaltung“ oft eine eigentümliche Mischung aus Naivität und Größenwahn aus. Nehmen Sie als Beispiel die derzeit en vogue gehandelten „Sustainable Development Goals“ (SDG) der Vereinten Nationen, kurz SDGs. Sie werden in bunten quadratischen Bildern gehandelt, ganz so, als ließe sich die Welt in 17 Kästchen einteilen und managen. Die Probleme der Welt werden auf Spielzeug und Bastelkarton-Niveau heruntergeschraubt und die Buntheit der Staffage suggeriert einen fröhlichen Blick in die Zukunft. Als wäre die Welt ein Baukasten, den sich jeder nach Belieben zusammenstellen kann. Inzwischen gibt es Schulprojekte zu den SDGs, bei denen die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, sich auszusuchen, mit welchem der bunten Kästchen sie sich am liebsten beschäftigen würden.
Warum sind wir derart auf die Zukunft fixiert, anstatt die Probleme der Gegenwart anzunehmen und unser Glück im Hier und Heute zu suchen? Einer der Gründe ist unser Sicherheitsbedürfnis. „Berufe mit Zukunft“ wollen uns die Angst nehmen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wobei dieses vage Versprechen, mit dem z.B. der Verbraucherservice Bayern Hauswirtschafts-Berufe anpreist, wohlfeil ist. Knackiger müsste es heißen: „Berufe der Hauswirtschaft sind Berufe mit garantierter Zukunft!“ Aber wer mag sich soweit aus dem Fenster lehnen? Schließlich war ja niemand von uns jemals schon da – in der Zukunft.
Ein weiterer Grund für unsere Zukunftsfixierung ist die verbreitete Idee, man müsse sich möglichst weitreichende, strategische und lohnende Ziele setzen, um voranzukommen. Ein erfolgreiches Leben, Arbeiten, Lernen etc. sei eines, das uns den Weg von A nach B weist, am besten direkt, ohne Umwege und Energieverlust. In Zeiten und unter Umständen, in denen die Welt stabil und berechenbar ist, mag dieses Konzept aufgehen. Heute, wo die Welt immer vernetzter, schneller, komplexer und pluralistischer wird, die Zukunft also noch ungewisser erscheint als je, wird die Fixierung auf bestimmte Ziele als problematisch empfunden. Erfolgreiche Unternehmer, so hat man herausgefunden, sind eher mittel- als zielorientiert. Solche „Effectuators“ gehen nicht von A nach B, sondern von A nach X. Sie orientieren sich zunächst an den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten, orientieren sich nicht an einem irgendwann in der Zukunft erwarteten optimalen Ertrag, sondern an dem in absehbarer Zeit leistbaren Verlust, den sie für Versuche und Irrwege zu investieren bereit sind, suchen geradezu die Zufälle und unerwarteten Umstände, anstelle sie um jeden Preis vermeiden zu wollen, und gehen rasch und vielfältige Partnerschaften ein, um Impulse und Energien von außen aufzunehmen. Sie lassen sich also ablenken und wissen oft nicht so genau, wohin die Reise geht. Das Gegenteil finde ich in einem Tagungsbericht des Bayerischen Landesamts für Umwelt aus dem Jahr 2013. Die Tagung beschäftigte sich mit dem Thema „Energiewende gemeinsam gestalten – wie der Funke überspringt“. Es gibt ja kaum etwas Ungewisseres als die Frage, ob und wie die 2011 eher ungeplant und zufällig ausgerufene deutsche „Energiewende“ gelingen wird. Dennoch wurden die Teilnehmer besagter Tagung auf die Bedeutung klarer Ziele eingeschworen. Wir lesen auf Seite 9: „Stellen Sie sich das Gesicht eines Fahrkartenverkäufers der Bahn vor, wenn Sie eine Fahrkarte kaufen möchten ohne zu wissen, wohin Sie fahren wollen.“
Mittelorientiert, als „Effectuator“ vorzugehen, heißt nicht, sich zu verzetteln. Sondern die Dinge, die man unterwegs entdeckt, ohne sie vorher geplant zu haben, zu nutzen und – wenn sie Potenzial haben – mit vollem Energieeinsatz auszutesten. Ein Beispiel aus der Praxis von stratum: Landauf, landab gibt es Projekte an Schulen, um die Energieeffizienz und die Klimabilanz dadurch zu verbessern, dass man die Schüler mit einbezieht. Das Licht ausmachen, wenn es nicht benötigt wird, und die Heizung runterzudrehen, wenn man die Fenster zum Lüften aufmacht, solche Dinge bringt man den Kindern in diesen Projekten bei. Als wir 2010 in 13 Berliner Schulen mit solch einem Projekt begannen, wir nennen es „Köpfchen statt Kohle“, stießen wir bald darauf, dass weder Schüler noch Lehrkräfte in der Mehrheit verstanden hatten, wie ein Thermostat funktioniert – nämlich nicht wie ein Gaspedal oder Wasserhahn. Da wir Breitenwirkung erzielen wollten, standen wir vor der zunächst unlösbar empfundenen Aufgabe, allen Schülern und Lehrkräften der Schule beizubringen, die Thermostate auf einer optimalen Einstellung zu belassen und nicht ständig daran herumzudrehen. Bis wir herausfanden, dass einige der Schulen gar keine drehbaren Thermostate besaßen, sondern die Heizung an einer „zentralen Einzelraumsteuerung“ hing, sprich an einem Computer, den meistens der Hausmeister in seinem Zimmer stehen hatte. Erst erschien uns das als weiteres Hindernis, etwas gegen überheizte Klassen- und Nebenräume zu tun. Bis wir den Vorschlag machten, doch auch den Schülern einen solchen Computer mit Regelungszugriff zur Verfügung zu stellen. Wir sprachen darüber nicht nur mit der zuständigen Schul- und Bauverwaltung, sondern auch mit Schulleitern und dem Ingenieurbüro, das die zentrale Steuerung in die Schulen eingebaut hatte. Binnen eines Jahres konnten wir unseren Vorschlag an drei Schulen erproben – und inzwischen sind von den 18 Schulen, die wir in Berlin betreuen, 14 auf diesen Zug aufgesprungen. Vor einem halben Jahr haben wir für diese Innovation den Handelsblatt Energy Award gewonnen.
Also: Nicht abarbeiten, was im Auftrag stand und was man vorausgeplant hat, sondern Zufälle nutzen. Das ist nicht trivial, denn oftmals sehen wir die Zufälle nicht, die sich auftun. Wir sind „aufmerksamkeitsblind“, weil wir uns zu sehr auf ein Ziel und eine vorgefasste Lösung und Vorgehensweise konzentrieren. Sicher kennen einige von Ihnen die „Gorilla“-Übung von Daniel Simons. Ungefähr die Hälfte der Probanden sieht den Gorilla nicht, der da durch die Spielszene läuft, weil sie mit dem Zählen der Ballwechsel beschäftigt sind – also mit der Aufgabe, vor die sie gestellt wurden. Was macht es uns schwer, den Gorilla zu sehen? Zum einen Pflichtbewusstsein: „Alles richtigmachen, was einem aufgetragen ist“. Oder auch eine gewisse Zweckökonomie: „Nur abliefern, was verlangt wird“.
Außerdem spielt wahrscheinlich auch die Tendenz, Störungen eher auszublenden und potenzielle Probleme zu ignorieren, eine Rolle. Effectuators gehen nach einer anderen Devise vor: Sie lieben das Problem. Nicht, um es sofort zu lösen, sondern als Erfahrung des Widerstands der Welt gegenüber den eigenen Vorstellungen – und als Hinweis auf neue Chancen. Normalerweise nutzen wir Probleme nicht als Chancen, sondern versuchen sie, so effizient wie möglich zu lösen, indem wir das Nächstliegende tun. Wie z.B. derzeit in St Peter Ording. Dort sind die am Strand stehenden Hütten auf Stelzen in Gefahr. Der NDR berichtet am 9. Januar 2018: „Schon seit mehr als 100 Jahren trotzen sie der Nordsee und ihren Sturmfluten. Und hoch über dem Meer haben die Gäste eine wunderbare Sicht auf die einzigartige Strand- und Wattlandschaft. Doch die Pfahlbauten sind in Gefahr. Schuld daran ist vor allem der Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel. Er sorgt dafür, dass der Strand immer schmaler wird. Experten des Küstenschutzes haben berechnet, dass jedes Jahr sechs bis zehn Meter Strand verloren gehen. Damit die Pfahlbauten auch in den kommenden 20 Jahren noch sicher sind, müssten sie um bis zu 200 Meter nach hinten verlegt werden, sagt ein Sprecher des Nationalparks Wattenmeer.“ Anstatt einen Ideenwettbewerb zu starten und nachhaltigere Alternativen zu finden, anstatt die Situation als Chance zu nutzen, mit dem Klimawandel offensiv umzugehen, wird mit mehreren Millionen Euro versucht, den Status quo möglichst zu erhalten – für gerade einmal 20 Jahre. So problemscheu und alternativenblind können wir sein!
Das Beispiel zeigt auch, wie sehr wir uns unter Handlungs- und Entscheidungsdruck setzen lassen bzw. selbst setzen. Es scheint so, als ob die zunehmende Informationsdichte und mediale Vernetzung diese Tendenz noch verstärkt. Täglich prasseln zig, wenn nicht Hunderte von Meldungen, Katastrophenwarnungen, Hilferufe, Meinungen und Appelle auf uns ein. Es fällt immer schwerer, die Orientierung zu behalten, und die Unsicherheit nimmt zu. Wem soll man glauben, wieviel ist wahr, was ist wichtig? Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat festgestellt, dass diese kognitive Überforderung zu einem „Deutungszwang“ und „kommentierenden Sofortismus“ führt. Er erklärt: „Damit meine ich – im Angesicht oft unsicherer, aber sofort verfügbarer Informationen – die Ad-hoc-Interpretation mit maximalem Wahrheitsfuror.“ Auf den Social-Media-Kanälen ist das Phänomen täglich zu besichtigen, aber es wird durch sie nur verstärkt, nicht verursacht. Die meisten von uns fühlen sich genötigt, zu allem eine Meinung zu haben, Stellung zu beziehen und sich festzulegen. Kein Politiker, der sagen würde: „Eine Minderheitsregierung hat Vor- und Nachteile. Ich kann nicht abschätzen, was in ein paar Monaten oder Jahren überwiegen wird.“ Oder: „Eine Obergrenze für Flüchtlinge könnte ein Mittel sein. Ob wir es anwenden sollten, hängt von mehreren Faktoren ab. Wir können heute nicht einschätzten, wie die Dinge sich entwickeln. Wir sollten deshalb einen ersten Kompromiss suchen, um nach einem Jahr neu zu entscheiden.“ Für einen Politiker wären solche Sätze tödlich. Erstaunlich ist, dass sich auch die Zivilgesellschaft in diesen Festlegungszwang pressen lässt. Die meisten von Ihnen dürften eine klare Einstellung zu Klimawandel, Gentechnik, Ökolandwirtschaft oder Flüchtlinge haben. Obwohl diese Themen ein hohes Maß an Ungewissheit und Unsicherheit beinhalten, haben Sie alle eine prinzipielle Einstellung dazu. Kaum jemand folgt dem Rat von Dirk von Gehlen, der das Schulterzucken (den „Shruggie“) zur adäquateren Reaktion erklärt. „Im Umgang mit dem Unübersichtlichen helfen gerade keine prinzipiellen Herangehensweisen“, schreibt Gehlen in seinem jüngst erschienen Buch „Das Pragmatismus-Prinzip“.
Als „Shruggie“-Verweigerer sind wir tendenziell gefährdet, zum Opfer von Verschwörungstheorien zu werden und uns manipuliert zu fühlen. Denn offenbar nehmen andere die Dinge genauso ernst wie wir – nur aus einer anderen Perspektive. Von der „klaren Einstellung“ gegen Glyphosat ist es nicht allzu weit, sich vergiftet und verseucht zu fühlen. Sie werden vielleicht sagen, die Menschen haben wirklich Angst, verseucht zu werden, sie fühlen sich verunsichert. Aber was könnte ihnen Sicherheit geben? Eine Welt ohne jedes Risiko? „Das Gegenteil von Angst ist nicht Sicherheit, sondern Toleranz für Risiken“, antwortet uns Dirk von Gehlen. Die Frage ist, wie wir uns diese Toleranz aneignen – in einer Welt voller Bedrohungen und Ungewissheiten.
Ein Rationalist könnte sagen: Nichts leichter als das! Eröffnet uns doch das Internet die Chance, zu jedem Thema nahezu alle relevanten Informationen zu recherchieren und die verschiedenen Seiten eines Problems zu beleuchten. Das Gegenteil trifft zu: Das Internet und Social-Media-Kanäle tragen keineswegs dazu bei, unsere Meinung zu differenzieren oder gar zu verändern. Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Tali Sharot hat herausgefunden: „Paradoxerweise macht uns die Fülle an verfügbarer Information weniger bereit, unsere Meinung zu ändern, weil es so leicht ist, an Daten zu kommen, die die eigene Weltsicht unterstützen.“ Facebook ist also nicht die Ursache für Filterblasen und Echokammern, sondern nur ein Mittel, das uns hilft, unsere Meinung zu behalten. Wir tun das aber auch sonst in der Wahl unserer Tageszeitung, unserer Freundeskreise und unserer TV-Sendungen. Wir suchen vor allem Bestätigung. Tali Sharot hat sogar festgestellt: „Menschen mit höher entwickeltem analytischen Denken verdrehen Daten mit größerer Wahrscheinlichkeit als Menschen, die im logischen Schlussfolgern weniger geübt sind…. Es entbehrt nicht der Ironie, dass Menschen ihre Intelligenz nicht dazu nutzen, genauere Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern dazu, Unzulänglichkeiten an Daten zu entdecken, die ihnen nicht passen.“ Der Harvard-Psychologe Steve Pinker kommt in seinem aktuellen Buch „Aufklärung jetzt“ ebenfalls zu diesem Ergebnis: „Menschen, die an den Klimawandel glauben“, so sagt er im Interview mit dem SPIEGEL, „sind nicht besser über die wissenschaftliche Forschungslage informiert als jene, die den Wandel leugnen. Oft ist es sogar umgekehrt.“ Die Einstellung zum Klimawandel entspreche nicht der eigenen Aufgeklärtheit, sondern viel eher der Zugehörigkeit zum jeweiligen sozialen Umfeld.
Nicht Daten und Fakten sind es also, mit denen Menschen erreicht und beeinflusst werden können. Was uns motiviert und verbindet, findet nicht im cerebralen System unseres Großhirns statt, sondern in den Regionen, die von Emotionen gesteuert werden. Das ist heute eigentlich weitgehend bekannt, aber es wird zum Beispiel von engagierten Menschen wie Ihnen doch kaum bewusst eingesetzt und genutzt. Immer noch versuchen wir, in erster Linie zwei Dinge, um andere zu überzeugen und auf unsere Seite zu ziehen: Erstens bringen wir Fakten und rationale Gründe vor. Ich zitiere noch einmal Tali Sharot: „Zahlen und Statistiken sind nötig, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, aber sie reichen nicht aus, um Überzeugungen zu ändern, und sie sind so gut wir nutzlos, wenn es darum geht, zum Handeln anzuspornen“. Okay, sagen wir uns, dann probieren wir es eben mit Angstmache. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Menschen werden krank vom Feinstaub, immer mehr Arten sterben aus. Das Dumme ist, das bewegt uns nicht, es ändert unser Verhalten kaum und motiviert die wenigsten zum Handeln. Die Neuropsychologie weiß: „Wir sind biologisch so gestrickt, dass uns die Erwartung guter Aussichten zum Handeln treibt.“ Denn: „Das menschliche Gehirn ist so gebaut, dass es aktives Handeln mit Belohnung assoziiert und nicht mit Schadensvermeidung.“ Das bedeutet, dass „wir eher zum Handeln neigen, wenn wir etwas Gutes erwarten als wenn wir etwas Schlimmes befürchten müssten.“ Aber, werden Sie vielleicht sagen, wir haben doch die Katastrophenpädagogik längst hinter uns gelassen, wir haben eine positive Idee, es ist die Nachhaltigkeit! Lasst uns die Zukunft nachhaltig gestalten!
Warum kommt diese Botschaft nicht so recht an? Weil sie ein rein kognitives Konstrukt ist, das leider nicht die Kraft hat, Menschen emotional zu erreichen und zu verbinden. Wo entsteht Gemeinschaft und Begeisterung für eine Sache? Zum Beispiel im Fußballstadion. Und warum dort? Warum nicht hier, im Rathaus von Augsburg, auf einer Zukunftstagung? Ganz einfach: Nicht Kognition, sondern „„Emotionen fördern die Synchronisierung von Gehirnaktivität, indem sie jedermanns Aufmerksamkeit automatisch in dieselbe Richtung lenken und einen psychologischen Zustand hervorrufen, der Menschen dazu veranlasst, die Welt auf ähnliche Art und Weise zu sehen und entsprechend zu reagieren.“ (Tali Sahrot) Das bedeutet: Wir koppeln unsere Gehirne nicht durch kognitives Verstehen, sondern durch Emotion. Also umgekehrt: „Kopplung ist nicht das Ergebnis von Verstehen, sondern vielmehr die neuronale Grundlage dafür, dass wir einander verstehen“, wie der Neurowissenschaftler Uri Hasson von der Princeton University klarstellt. Also: Erst müssen wir eine emotionale Verbindung schaffen, danach können wir uns über gemeinsame Ziele und begründetes gemeinsames Handeln verständigen.
Das hat Auswirkungen z.B. auch auf die Werte-Debatten unserer Zeit. Werte sind als Motiv, als Gemeinschaft stiftender Faktor und als Handlungsgrund weitgehend irrelevant, wenn sie nicht auf einer vorausgehenden emotionalen Verbindung beruhen. Werte begründen keine Gemeinschaft, sondern liefern nur bestehenden Gemeinschaften oder Feindschaften eine nachfolgende Rechtfertigung – und zwar als Abgrenzung gegenüber anderen Wertewelten oder Moralvorstellungen. Aus diesem Grund hat der Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann festgestellt, dass sich heutige differenzierte Gesellschaften nicht durch Ethik oder Moral integrieren, also zusammenhalten lassen. Mit Bezug auf die umwelt- oder nachhaltigkeitspädagogische Intention, die viele von Ihnen mitbringen, müssen wir feststellen, dass Werte das soziale Lernen nicht beeinflussen. Die oft verblüffend gleichförmige Entwicklung und Veränderung von Einstellungen und „Stimmungen“ in der Bevölkerung basiert nicht auf einer Evolution der Werte, sondern lässt sich eher durch so etwas wie Schwarmverhalten erklären. Die alle Jahre wechselnden Beliebtheitsskalen der Vornamen, die Eltern ihren Kindern geben, sind ein Beispiel für die unbewusste kollektive Abstimmung.
Aber Schwärme können sich doch intelligent verhalten? Eine Zeitlang war Schwarmintelligenz als Aufwertung des Demokratieprinzips in der Diskussion. Heute wissen wir aus der sozialpsychologischen Forschung, dass die vielen nur unter ganz bestimmten Bedingungen weiser sind als der Einzelne – nämlich dann, wenn sie sozial nicht miteinander interagieren. Da unsere gesamte Lebenswelt sozial organisiert ist, finden wir wenige Nischen für Schwarmintelligenz – wohl aber jede Menge Belege für „Schwarmdummheit“, wie der Mathematiker und frühere IBM-Technologiechef Gunter Dueck es nennt. Insbesondere unser Arbeitsalltag in Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen werde von ritualisierten Meetings, sinnlosen Besprechungen, schlechten Kompromissen und neurotischen Strukturen beherrscht.
Was aber noch gravierender ist, ist die Schwarmdummheit unseres politischen Systems. Der Physiker und Soziologe Dirk Helbing hat in einem Beitrag für die FAZ auf die Zusammenhänge hingewiesen: „Möglicherweise ist es problematisch, dass wir politische und wirtschaftliche Entscheidungen in ständig miteinander diskutierenden Gremien treffen. Man verliert das Bewusstsein für die Fragwürdigkeit der eigenen Position und verwechselt Konsens mit Richtigkeit. Stattdessen sollte man sich der Gefahr eines Irrtums bewusst bleiben und genauer auf abweichende Meinungen hören.“ Dieses Hören auf abweichende Meinungen haben wir in unseren Systemen nicht verankert. Deshalb bleiben es oft nur Provokationsnischen, die allein deshalb bestehen können, weil sie sich auf die Freiheit der Kunst berufen. Die Publizistin Carolin Emcke diagnostiziert: „„Wenn … individuelle Einschätzungen oder Handlungen immer schon zu kollektiven Dispositionen verallgemeinert werden, dann verkommt die öffentliche Auseinandersetzung zu antagonistischer Identitätspolitik, die nur noch in statischen Wir-gegen-sie-Kategorien agieren kann.“ Und als Ausweg fordert sie: „Ein kluger Pragmatismus ist jetzt gefragt, der auf große Visionen, die endgültige Lösungen versprechen, verzichtet.“
Ein solcher Pragmatismus fällt vielen von uns schwer, die wir mit Visionen der Weltrettung umgehen und von der Politik vor jeder Regierungsbildung den großen „Aufbruch“ erwarten. Schon Paul Watzlawick hat dieses Problem als „Utopie-Syndrom“ beschrieben, dem er ein ganzes Kapitel seines Buches „Lösungen“ widmet. In zwei Ausprägungen hindert uns das Utopie-Syndrom, hier und heute etwas zur Verbesserung der Welt zu tun: Entweder wir schieben Entscheidungen und Handlungen immer wieder hinaus, weil die Aufgabe ja so groß und der Weg so weit ist. Diese Aufschiebehaltung macht den Weg zum Ziel, bewirkt natürlich gar nichts, aber belässt uns in dem guten Gefühl, auf der richtigen Seite des Lebens zu stehen. Die andere Variante des Utopie-Syndroms besteht darin, die vielen Widerstände und Hürden bis zur Verwirklichung der Utopie und die eigene Erfolglosigkeit nicht sich selbst zuzuschreiben, sondern den bösen Gegenkräften und den vielen Uneinsichtigen um uns herum. Auch das rechtfertigt letztlich mein Verharren in Nichtstun und Ineffektivität und einer negativen Einstellung gegenüber bestehenden echten Handlungsoptionen.
Auch die Einstellung eines Dennis Meadows könnte man in die Kategorie Utopie-Syndrom einordnen. Meadows, Autor der „Grenzen des Wachstums“ (1972) sagt heute: „Nachhaltige Entwicklung ist eine unsinnige Vokabel wie friedlicher Krieg. Es gibt keine Entwicklung mit Nachhaltigkeit.“ Ulrich von Weizsäcker bescheinigt Meadows explizit, zynisch geworden zu sein, obwohl auch er Zweifel an einer nachhaltigen Entwicklung hat.
In seinem jüngsten Interview mit dem Wirtschaftsmagazin agora stellt Weizsäcker fest: „Die Menschheitsgeschichte deutet darauf hin, dass es keinen weichen Übergang geben wird.“ Und der Doyen der deutschen wissenschaftlichen Ökologie, Wolfgang Haber, kommt in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag zur „Welt des Anthropozän“ zu diesen Schlüssen:
- Humanität und Ökologie seien grundsätzlich unvereinbar und bestimmen die Tragik des „Doppelwesens“ Mensch als geistbegabtem Säugetier
- Diese Unvereinbarkeit können wir nur durch ständige Kompromisse zeitweilig überbrücken
- Die Übertragung humanitärer Prinzipien auf die Organisation des gesamten natürlichen Lebens auf der Erde muss scheitern
- Ökologische Selbstregulierung wird im Zeitalter des Anthropozän das Schicksal der menschlichen Population bestimmen, ohne dass wir es verhindern können.
Beide Wissenschaftler, Weizsäcker wie Haber, sind darüber aber nicht zu Zynikern geworden, sondern haben eine grundsätzlich optimistische Haltung. Der Unterschied sind nicht die Fakten und die Einsicht in die prekäre Entwicklung des Planeten. Der Unterschied liegt woanders.
Aber wo? Kurz vor dem Ende des Jahres 2017 starb in Berlin der Schriftsteller Martin Keune an einem Gehirntumor. In seinem Abschiedsbrief stehen die Worte: „Wo ich jetzt bin, werdet Ihr bald sein. Tut vorher, was getan werden muss.“ Wenn es eine Botschaft aus der Zukunft gibt, dann offenbar diese. Aber wo liegt nun der Unterschied? Keune benennt ihn genial unscheinbar: „Esst jede Portion Spaghetti, als ob es die erste wäre.“ Gewöhnlich ist die Mahnung ja eine andere: „Genieße jeden Tag, als ob er der letzte wäre!“ Das ist der Unterschied: Lebe und handle nicht im Bewusstsein der Endlichkeit und in der phantasierten Angst vor dem Tod. Sondern aus Neugierde auf die Welt und auf das, was du noch nie gesehen, geschmeckt, gefühlt hast… Niemand von uns hat eine Zukunft über sein Leben hinaus, niemand wird je „nachhaltig“ leben. Was zählt, ist das, was wir heute tun – und wie wir es tun.
Der Klimaskeptiker in uns
Januar 2018
Dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun verdanken wir das Bild des „inneren Teams“. Dahinter steht die hilfreiche Vorstellung von der Pluralität unserer Bedürfnisse, Meinungen, Einstellungen und Handlungsmotive. In diesem Team, das die Vielfalt unseres Seelenlebens widerspiegelt, gibt es Anführer, Unterdrückte, Intriganten, Ängstliche, Draufgänger, Mahner usw. Das Bild hilft uns, toleranter mit uns selbst umzugehen und aufmerksamer zu werden für die Diversität und Widersprüchlichkeit in unserem eigenen Inneren. Es soll uns auch skeptischer uns selbst gegenüber machen. Und das Modell löst den oft beklagten Widerspruch zwischen Denken und Handeln auf. Niemand ist konsistent!
Überspitzt hat man festgestellt, dass das bedeutet, dass auch in jedem von uns ein potenzieller Mörder steckt. Wie es aussieht, steckt aber auch in jedem von uns ein kleiner Klimaskeptiker. Wahrscheinlich gehört es zur psychischen Gesundheit, ihn nicht zu verleugnen. Zwei anekdotische Erlebnisse der letzten Wochen haben uns wieder einmal auf dieses Mitglied unseres inneren Teams aufmerksam gemacht.
In einem Gymnasium beteiligt sich eine Schulklasse über mehrere Jahre an einem Energie- und Klimaprojekt. Innerhalb der Schule unterstützt ein Physiklehrer die 13- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler bei ihrem Engagement, den Energieverbrauch der Schule und damit die Klimabilanz des Gymnasiums zu verbessern. Im zweiten Jahr des Projekts geht es um das CO2 im Klassenraum ebenso wie das CO2 als Treibhausgas. Während die einen Schüler das richtige Lüften im Winter diskutieren, wollen die anderen durch Bäume pflanzen den CO2-Ausstoß ihrer Schule neutralisieren. Beide Themen hängen beim Kohlendioxid zusammen und geben Anlass zur Vermittlung allgemeinen chemisch-physikalischen Grundlagenwissens. In dieser Situation überrascht der Physiklehrer seine Schüler mit der Ansage, das mit dem Treibhauseffekt des CO2 könne nicht stimmen, denn CO2 sei doch schwerer als Luft und somit könne sich in größerer Höhe nicht eine Art „Glashaus“ entwickeln. Wer wisse also, ob es diesen Klimawandel wirklich gebe.
An einer anderen Schule, die sich rühmt, „Umweltschule“ zu sein, und diesen Titel auch offiziell führt, nutzt die Schulleiterin den Wechsel beim zuständigen Hausmeister, um diesem eine Anweisung für den Betriebsfrieden zu geben: Er solle doch einfach alle Klassenräume den ganzen Schultag über auf 22 Grad Celsius beheizen, dann gebe es keine Probleme. Die in einem Energieprojekt an dieser Schule aktiven Fünft- und Sechstklässler kämpfen auf der anderen Seite jede Woche am Steuerungscomputer der Heizung darum, unnötige Heizzeiten einzusparen und die Warmtemperatur möglichst auf 20 Grad zu fixieren.
Was sagt uns das? Es gelingt dem kleinen Klimaskeptiker in uns immer wieder mal, sich in den Vordergrund zu drängen. Darf er das? Sollten ihm seine Teamkollegen denn nicht längst den Garaus gemacht haben? Wir finden, er darf das und er muss es sogar, weil er als Teil unseres inneren Teams für unsere psychische Balance mitverantwortlich ist. Wenn wir ehrlich sind, spielt er in unser aller innerem Team eine Rolle. Er ist es, der uns nicht verzweifeln lässt angesichts der Katastrophenmeldungen des IPCC und der schieren Unfähigkeit internationaler Konferenzen, einen weltweiten radikalen Kurswechsel in der Energiepolitik einzuleiten. Der uns dann doch Autofahren, fliegen und Fleisch essen lässt. Und Kinderkriegen. Der kleine Klimaskeptiker in uns ist ein verdammter Realist, der uns davor bewahrt, einzelne Wahrheiten, die wir – so wie die ungemein komplexen Klimamodelle – gar nicht selbst wirklich überprüfen können, zu verabsolutieren. Wir müssen ja weiterleben, auch wenn wir von katastrophalen Ereignissen umgeben zu sein scheinen. Geben wir ihm also seinen Raum. Denn er ist es, der uns trotz aller ökologischen Untergangsmeldungen eine gewisse innere Balance ermöglicht, ohne die wir weder handlungsfähig wären noch zukunftsoffen sein könnten.
Dialektik der Nachhaltigkeit – Was man in Island lernen kann
September 2017
Nachhaltigkeit wird zum Thema und zum Problem durch wirtschaftliches Wachstum und Übernutzung von Ressourcen – sowohl natürlichen wie menschlichen. Allerdings kann extremes Wachstum in einem Sektor dazu beitragen, dass die Nachhaltigkeit in einem anderen Sektor größer wird. Wie es scheint, ist Nachhaltigkeit doch kein universelles, sondern nur ein sektorales Konzept. Das kleine Island ist aufgrund seiner exorbitanten Wachstumsdynamiken ein gutes Anschauungsbeispiel dafür.
Die beliebte Insel im Nordatlantik wirbt schon am Flughafen großformatig damit, das Land der „grünen“ Energie zu sein und begrüßt die immer größer werdenden Scharen von Touristen mit der gewissensentlastenden Botschaft, in ein „carbon-free country“ zu kommen. Schon 2008 formulierte der seinerzeitige Wirtschaftsminister Össur Skarphédinsson das Ziel, bis 2050 ohne jegliche fossile Brennstoffe auszukommen. Tatsächlich basiert Islands Wirtschaft heute bereits auf 85 Prozent erneuerbarer Energie, wie uns der Kommunikationschef von OR Reykjavik Energy, Eiríkur Hjálmarsson, berichtete. Anfang September waren ein Dutzend Nachhaltigkeitsexperten aus Deutschland mit stratum in Island unterwegs, um sich unmittelbares Bild zu verschaffen. Zurück kamen sie mit einem sehr viel differenzierteren Bild des nachhaltigen Island, als es in der Werbung geschildert wird.
Island hat drei große Wirtschaftszweige – die traditionelle Fischerei, die in den letzten zehn Jahren stark gewachsene Aluminium- und Siliziumindustrie und den Tourismus, der seit dem Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 gigantische Steigerungsraten aufweist. In diesem Jahr kommen 2,3 Millionen Besucher in das Land, das selbst nur 330.000 Einwohner hat. Die Abhängigkeit vom Tourismusgeschäft, das die agilen Isländer rasant angekurbelt haben, ist inzwischen so groß, dass uns die Chefin der isländischen Tourismusagentur, Ólöf Ýrr Atladóttir, sagte: „Wenn die Touristenzahlen aus irgendeinem Grund wieder stärker zurückgehen sollten, bekommen wir einen größeren Crash als in der Bankenkrise 2008.“
Nachhaltigkeit wird meistens diskutiert als Eingrenzung der schädlichen Auswirkungen von Wachstum. Der Tourismusboom in Island ist natürlich eine Gefahr für den Naturschutz und die sagenhaften Naturlandschaften auf der Vulkaninsel. Inzwischen gibt es einen richtigen „Krieg um das Hochland“, weil die löchrigen Pisten, die beispielsweise nach Kerlingarföll führen, einem beliebten Wandergebiet im südlichen Hochland, zu winterfesten Straßen ausgebaut werden sollen, wenn es nach den Betreibern der touristischen Einrichtungen geht. Einer von ihnen, Páll Gislason, sprach uns gegenüber sogar von „Öko-Terroristen“, die diese Pläne bekämpfen. Dennoch muss man feststellen, dass es bislang kaum Einschränkungen touristischer Aktivitäten durch den Naturschutz gibt. Die Isländer sind geschäftstüchtig und schnell im Nutzen von sich bietenden Chancen. „Longterm perspectives especially are difficult for Islanders“, bescheinigt der Geschäftsführer des „Icelandic Center for CSR“, Ketill Magnússon, seinen Landsleuten.
Der Tourismusboom erweist sich auf einer anderen Seite nun aber als Beitrag zur Nachhaltigkeit. In den 70er Jahren wurde nämlich in Island ernsthaft darüber nachgedacht, das Land zwischen den Interessen der Fischereiindustrie und der Energieerzeuger aufzuteilen. Man berechnete, wie groß die natürlichen Energieressourcen des Landes – Wasserkraft und Geothermie – sind und kam allein aus Wasserkraft auf 30 Terrawattstunden Strom. Was macht man mit so viel Energie? Eine Zeitlang geisterte die Idee herum, Island könne die „grüne Batterie“ Europas werden und „Naturstrom“ über dicke Stromkabel aufs europäische Festland schicken. Eine viel schneller realisierbare Geschäftsidee bestand jedoch darin, energieintensive Industrien wie z.B. Aluminiumschmelzen ins Land zu holen. Tatsächlich hat man damit vor über 10 Jahren begonnen, als weltweit die Energiepreise stiegen. Alcoa investierte 2005 in eine erste Schmelzhütte auf Island, nachdem der staatliche Energieversorger Landsvirkjun dem Unternehmen einen extrem niedrigen Strompreis für 40 Jahre garantiert hat. Heute produziert Island 800 Tausend Tonnen Aluminium pro Jahr und steht damit an 12. Stelle der Aluminiumlieferanten weltweit. Während ein Deutscher im Durchschnitt 7.000 kWh pro Jahr Energie verbraucht, kommen auf einen Isländer aufgrund des Energiebedarfs der Schwerindustrie 53.000 kWh, also fast das Achtfache!
Hätte man die Pläne aus den 70er Jahren konsequent weiterverfolgt, wären zahlreiche Ökosysteme und Naturschönheiten beeinträchtigt und zerstört worden, die heute als touristische Attraktoren gelten. Unter anderem war konkret geplant, den Wasserfall des Gullfoss für die Stromproduktion umzuleiten und ihn nur im Sommer, zur Hochsaison, wieder aufzudrehen. Es dürfte also dem einsetzenden Massentourismus, der heute nicht nur im Sommer in Island stattfindet, zu verdanken sein, wenn die weitere Naturzerstörung zugunsten der Energieproduktion aufgehalten wird.
Aus Energiesparen wird Energieeffizienz wird Lebensqualität
Mai 2017
Dass Energie gespart werden müsse, das ist ein Mantra, das wir Zeitgenossen der Nachhaltigkeit im Schlaf aufsagen können. Zumal im pädagogischen Bereich wird es täglich tiefer in den Gehirnen verankert, Energie nicht verschwenden, Wasser sparen und den Müll trennen, das bringen wir jedem nachwachsenden Schülerjahrgang schon in der Grundschule bei. Wir leben ja insgesamt über das Maß dessen, was uns global gesehen zusteht, so dass das Bild vom übergroßen Fußabdruck inzwischen auch den Zehnjährigen geläufig zu werden verspricht.
Das Paradigma vom Sparen löst sich allerdings zunehmend auf, je mehr sich zum Beispiel auch Schüler/innen mit der Realität der Energieverwendung in ihrem schulischen Umfeld beschäftigen. Wir betreuen eine Vielzahl von Projekten, die in Schulen mit dem Auftrag gestartet sind, mehr Energie im Gebäude einzusparen. Manche dieser Projekte werben um Mitarbeit sogar mit der Aussicht, die Hälfte der eingesparten Energiekosten in Euro an die jeweilige Schule auszuschütten. Doch siehe da, immer mehr dieser Projekte stoßen darauf, dass das Schielen nach den „Energielecks“ und Einsparpotenzialen den Blick verengt und nur eine begrenzte Vernunft für sich hat. Drei Beispiele:
- Licht. Braucht man zum Lernen in der Schule. Es gibt dafür auch Arbeitsplatznormen, die anzuwenden sind. Gehen nun engagierte Schüler durch die Klassenräume und messen die Beleuchtungsstärken an den Schülerarbeitsplätzen, stellt sich regelmäßig heraus, dass ein Drittel bis die Hälfte der Arbeitsplätze teilweise weit unter der Norm von 500 Lux liegt. Also lautet die Forderung der jungen Energiebeauftragten: Gebt uns mehr Licht! An der Beleuchtungsstärke zu sparen, um das Klima zu schützen, wäre ja auch so widersinnig, dass das niemand fordert. Mehr Licht ohne mehr Strom zu verbrauchen, ist nicht einfach. Ob das mit LED statt Leuchtstoffröhren gelingt, wird ansatzweise in den Energiesparprojekten jetzt diskutiert. Meist sind es die hohen Investitionen, die einer praktischen Überprüfung erst einmal Grenzen setzen.
- Luft. Auch das ist im Winter ein sehr oft knappes Gut in unseren Schulen, wenn die CO2-Werte im Klassenzimmer munter in Richtung 3000 ppm gehen. Ab 1000 ppm sollte aktiv gelüftet werden, heißt es in diversen Empfehlungen und Richtlinien. Da wir die Gebäude immer besser abdichten und die Fenster in den Schulen aus Sicherheitsgründen immer häufiger verschlossen bleiben, leidet die Konzentrations- und Lernfähigkeit der Schüler und wird zum Opfer der Energiespar- und Klimaschutzidee. Solange wir die Klassen nicht alle mit CO2-Messanzeigen ausstatten, effektive Lüftungspausen in den Unterrichtstag integrieren und durch intelligente Steuerungen dafür sorgen, dass die Heizungsthermostate während des Lüftens schließen, müssen wir uns entscheiden: Lernqualität oder Energiesparen.
- Wärme. In vielen Schulen bekommen wir das Thema „Wärme“ nicht wirklich in den Griff. So dass es effektiv ist – also ausreichend warm – und gleichzeitig effizient, also so wenig Energie wie nötig eingesetzt wird. Denn an den meisten Schulen wurde kein sauberer hydraulischer Abgleich der Heizung vorgenommen. Die Folge sind ungünstige Druckverhältnisse im Heizsystem, was in Teilen der Schule überhitzte und in anderen Teilen zu kalte Räume zur Folge hat. Kein Wunder, dass so mancher Schulhausmeister durch manuelle Eingriffe in die Systeme trickst und lieber so viel heizt als möglich, damit sich niemand beschwert. Denn die Temperaturregelung durch das dauerhafte gekippte Fenster stört uns sehr viel weniger als wenn es im Raum zu kühl ist. Auch ein Bürgermeister erzählte uns jüngst von seinem Hausmeister im Rathaus, der das Problem dadurch löst, dass er ein Zehn-Cent-Stück in den Thermostatkopf einbaut, damit der Ventilstift nicht mehr schließt.
Schülerinnen und Schüler, die wir mit dem Auftrag durch die Schulgebäude schicken, Energie zu sparen, lernen schnell, dass es nicht einfach ums Sparen gehen kann. Und wenn sie dann beginnen, sich mit der Effizienz des Energieverbrauchs auseinanderzusetzen, relativiert sich alles noch einmal. Denn ohne die Frage, welche Lebensqualität wir an unseren Schulen haben wollen, lässt sich keine Effizienzdebatte führen. Und wenn wir weiterhin an der sauberen technischen Anpassung der vorhandenen Systeme an die Gebäudeverhältnisse und die Nutzerbedürfnisse sparen, dürften die Schüler/innen den Glauben an die Rationalität unserer Nachhaltigkeitsappelle allmählich verlieren.
Die Erlösung des Konsumenten
Februar 2017
Mit dem Auftritt von Michael Kopatz in der Berliner stratum lounge schloss sich für den Gastgeber ein Kreis. Die Beratungsagentur stratum hatte sich nämlich 2008, als man mit dem Büro von München nach Berlin umgezogen war, in der Hauptstadt mit einer Studie zur Zielgruppe der LOHAS-Menschen vorgestellt, die in der „grünen“ Szene für Aufregung sorgte. Der „Lifestyle of Health and Sustainability“ (LOHAS) war seinerzeit als Merkmal einer Konsumentengruppe entdeckt worden, die die Welt allein durch die richtigen Kaufentscheidungen besser, ökologischer, nachhaltiger machen sollte. Allenthalben wurden große Hoffnungen in diese Option gesetzt, sich eine bessere Welt quasi kaufen zu können und Genuss und gutes Gewissen endlich unter einen Hut zu bringen. Der Abschied vom Verzichts-Ethos der grünen Bewegung schien eine psychohygienische Kraft zu entfalten. Plötzlich bekam die Vision einer umweltverträglichen Zukunft unseres Lebensstils wieder Nahrung. Der „strategische Konsum“ sollte die Welt retten.
Und dann die stratum-LOHAS-Studie, die im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt durchgeführt wurde. Am 6. November 2008 berichtete Peter Unfried in der Tageszeitung taz ausführlich über die
Ergebnisse – unter der Headline „Die Öko-Egoisten“. Auch die LOHAS entpuppten sich in erster Linie
als Konsumenten, auf ihren Vorteil bedacht. Die ständige Herausforderung, irgendwie das eigene Ökogewissen beruhigen zu müssen, macht die Zielgruppe anfällig für Greenwashing. LOHAS leben mit der
latenten Verunsicherung, das Richtige zu tun. Die moralische Anforderung, als Konsument die Welt nicht zu schädigen, führt in einen dauerhaften Zwiespalt. Als Entlastung kauft man Bio, fliegt
aber dennoch zweimal im Jahr in die Ferne. Es ist bekannt, dass gerade Grünen-Wähler am häufigsten fliegen.
Erlösung für den Konsumenten kommt jetzt aus dem Wuppertal Institut, dem renommierten Think Tank der Nachhaltigkeit. Wuppertal-Wissenschaftler Michael Kopatz hat ein Buch geschrieben, das „Ökoroutine“ heißt (oekom verlag, EUR 24,95). Zum Autorenabend bei stratum kam er mit einer "nachhaltigen" Trinkflasche für Leitungswasser. Seine Botschaft war aber eine ganz andere: Kopatz entlässt den Konsumenten aus der Verantwortung für Ökologie und Nachhaltigkeit. In seinem Buch zeigt er, was wirklich helfen kann, den Klimawandel und die Umweltkrise zu bekämpfen: Einfache, aber wirksame strukturelle Maßnahmen durch die Politik. Zum Beispiel:
- Ende des weiteren Straßenausbaus
- Schritt für Schritt die gesetzlichen Anforderungen an die Landwirtschaft auf Bio-Niveau heben
- Nach und nach alle umweltschädlichen Subventionen radikal abbauen
- Werbebeschränkungen für ungesunde und klimaschädliche Produkte.
Am Beispiel des Rauchens oder der gesetzlichen Anforderungen der Energieeffizienz von Gebäuden exemplifizierte der Wissenschaftler den Effekt solcher Maßnahmen, die „natürlich immer gegen Widerstand“ durchgesetzt werden müssen. Aber es geht.
Damit dürfte das Ende der LOHAS-Ära in der Nachhaltigkeitsdebatte offiziell besiegelt sein. Michael Kopatz rechnet uns in seinem 400-Seiten-Buch für jeden unserer Konsumbereiche
vor, dass und wie staatliche und wirtschaftspolitische Eingriffe so viel effektiver sind als Appelle an das Öko-Gewissen des Konsumenten. Aber nicht nur für die Verbraucher brächte eine von oben
verordnete Öko-Routine eine immense Entlastung. Auch Konzernchefs sind zu 80 % der Auffassung, dass nur strengere gesetzliche Vorgaben und Kontrollen zu einer nachhaltigeren
Wirtschaftsform führen.
Was fehlt ist der Mangel an wissenschaftlicher Expertise zu Ökoroutinen. Es werde hier einfach nicht geforscht, bemängelte Kopatz. Degrowth Konferenzen, auf denen das Wachstum symbolisch bekämpft
wird, seien kein Ersatz dafür. „Nur zu schrumpfen, wäre katastrophal“, meint Kopatz und erzählt, dass er in diesem Punkt auch seinem Kollegen Nico Paech gerne widerspricht.
Einen Haken hat die Sache aber: Die Politik lässt sich von Michael Kopatz (bisher) nicht beraten. Er werde von Politikern nicht angefordert, berichtete er auf Nachfrage von stratum, denn „die Politiker glauben immer, sie haben selbst bereits die Lösungen“.
Können wir Nachhaltigkeit lernen?
Januar 2017
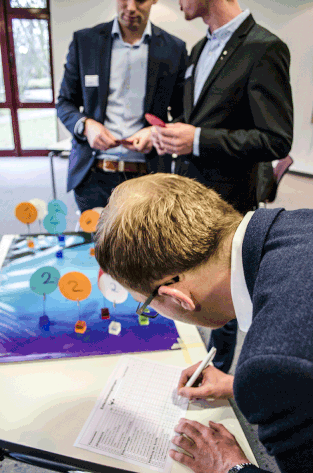
Von Dennis Meadows, dem Autor der legendären „Grenzen des Wachstums“-Studie von 1972 stammt eine Wirtschaftssimulation, die wir bis heute in Führungstrainings, Nachwuchs-Workshops und in der politischen Bildung einsetzen. Bei dem computergestützten Simulationsspiel geht es um die Befischung verschiedener Meeresgebiete, die Mitspieler bilden konkurrierende Unternehmensteams. Die Aufgabe ist, wirtschaftlich erfolgreich zu agieren, ohne die ökologischen Grundlagen des eigenen Wirtschaftens zu ruinieren.
Obwohl Meadows Fortschrittspessimist ist, ist „Fish Banks“ nicht vor dem Hintergrund einer Katastrophenpädagogik konstruiert, sondern basiert auf seriösen Populationsdynamiken von Fischbeständen
der Hochsee und küstennaher Fanggründe. Die Katastrophen erzeugen fast regelmäßig die Teilnehmer der Simulations-Workshops.
Spiel oder Ernst? Immer, wenn wir mit dem Führungs- und Unternehmernachwuchs einen "´Fish Banks"-Workshop veranstalten, wird aus dem Simulationsspiel schnell eine ernste Situation: Schaffen es
die konkurrierenden Fischereiunternehmen zu einer nachhaltigen Fangstrategie zu kommen? Oder ist das Meer dann doch nach einigen Jahren (Spielrunden) leer gefischt? Klappt ein zweiter Versuch
besser? Die Dynamiken, die hier am Werk sind, machen hinterher sehr nachdenklich. Sind wir für Nachhaltigkeit doch nicht geschaffen?
Die beiden folgenden Grafiken zeigen ein durchaus repräsentatives Bild der Spielverläufe. Der erste Versuch (linkes Diagramm) zeigt ein Scheitern, also die totale Überfischung aller Fanggebiete,
nach fünf Jahren (= Spielrunden). Das Geschehen war hier getrieben von einem der sechs Teams, das sehr expansiv auftrat, seine Flotte rasch vergrößerte und das Geschehen beherrschte. Nur
in zwei der Teams, die aus jeweils vier bis fünf Mitgliedern bestanden, machte man sich die Mühe, aufgrund der Daten der jeweiligen Fangjahre Berechnungen anzustellen, um die Entwicklung der
Erträge pro Schiff zu berechnen. Bezeichnenderweise waren dies Teams, in denen nicht die Männer den Ton angaben, sondern mehrere Frauen waren. Allerdings trauten diese sich nicht, ihre
Erkenntnisse in „Politik“ umzusetzen. Sie zogen zwar für ihr eigenes Unternehmen die richtigen Schlüsse, aber ließen die anderen Firmen mit ihrer expansiven und stark kompetitiven Strategie
gewähren.
Im zweiten Durchgang, als die Teams also bereits einmal auf die Nase gefallen waren und die Risiken besser einzuschätzen wussten, lagen dann auch auf allen Tischen Smartphones als Taschenrechner. Auch wurde der Versuch gemacht, im Fischerei-„Verband“, in den alle Teams ein Mitglied entsandten, Absprachen zu treffen und durchzusetzen. Das erwies sich jedoch als schwierig und am Ende unmöglich, weil die Unternehmensstrategien der verschiedenen Teams doch sehr unterschiedlich waren und die stärker auf Wettbewerb und Expansion ausgerichteten Teams im Grunde bei ihrer Strategie blieben. Trotz der Taschenrechner schafften es die Mitspieler, die Hochsee in sechs Fangjahren wieder an den Rand des Ruins zu bringen. Man hatte nicht darauf geachtet, die unterschiedlichen Bedingungen in den Fanggebieten zu berücksichtigen, sonst hätte man sich von den Fängen an der Küste nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass die Hochsee bald wieder fischleer sein würde.
Was sich aus solchen Erlebnissen und Spielerfahrungen lernen oder auf die Wirklichkeit übertragen lässt, hängt davon ab, aus welcher Lebenswelt die Mitspieler jeweils kommen. Vor kurzem haben wir
„Fish Banks“ mit dem politisch interessierten Nachwuchs aus der Landwirtschaft gespielt. Dabei zeichneten sich am Ende zwei Reaktionen auf die aufwühlenden Spielerfahrungen ab. Die einen
versuchten, durch Firmenfusionen und -aufkäufe die schwierigen Abstimmungs- und Entscheidungskämpfe in der Branche zu minimieren, andere Gruppen gaben auf mit der Begründung:
„Wir wollen nicht in einem Bereich wirtschaften, in dem wir natürliche Ressourcen nur ausbeuten, aber nichts aktiv dazu beitragen können, dass etwas nachwächst. Wir verkaufen die Fischereifirma
und investieren wieder in Landwirtschaft.“ Dass man auf den Weltmeeren nicht säen muss, um zu ernten, war diesen jungen Meinungsführern aus der Landwirtschaft ein Problem, dem sie
entgehen zu können glauben, wenn sie statt auf bewegten Meeren auf der festen Scholle agieren.
Dass das ein Trugschluss ein könnte, zeigen die jüngsten Äußerungen des Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), Carl-Albrecht Bartmer. Dieser nämlich wies darauf hin,
dass zu enge Fruchtfolgen und ein zu hoher Chemikalieneinsatz in der Landwirtschaft inzwischen zu sinkenden Ernteerträgen führen. Immer mehr Pflanzenschädlinge und Krankheitserreger in der
Tierhaltung entwickelten Resistenzen gegen die eingesetzten Mittel. Am Denken in ökologischen Systemen führt nichts vorbei, rein lineare Wachstumsstrategien funktionieren
nirgends.